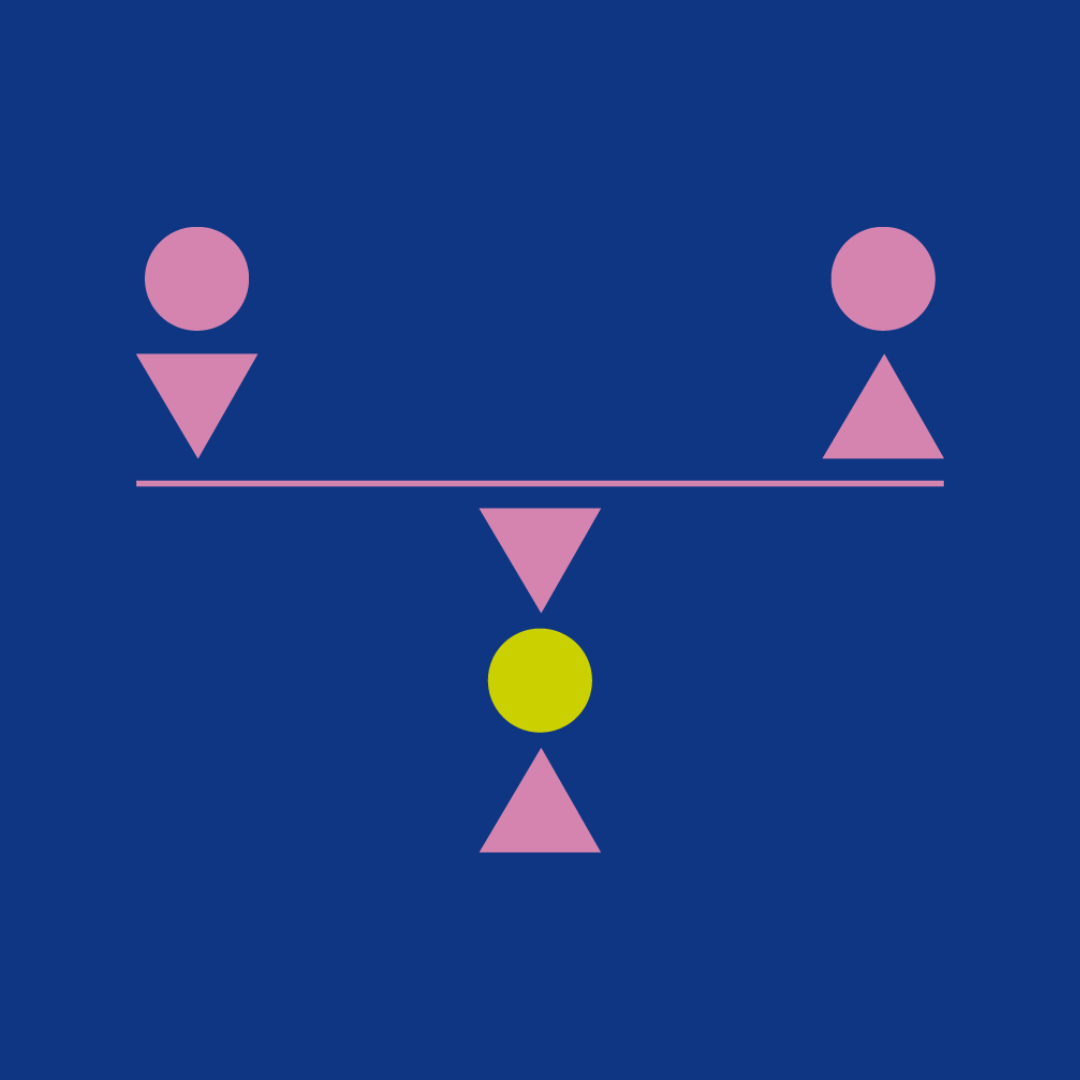KDFB: Klares Nein zu Genitalverstümmelung

Foto: Pixabay
Zum Internationalen Tag gegen Genitalverstümmelung am 6. Februar fordert der Katholische Deutsche Frauenbund e.V. (KDFB) die Politik auf, sich vehement für die weltweite Beendigung weiblicher Genitalverstümmelung und Beschneidung einzusetzen. „Diese Praktiken sind eine tiefe Verletzung der Menschenrechte und Missachtung der Würde von Mädchen und Frauen. Sie geschehen nicht nur in fernen Ländern, sondern auch in Deutschland und Europa“, stellt KDFB-Vizepräsidentin Sabine Slawik fest.
Weibliche Genitalverstümmelung ist Ausdruck tief verwurzelter Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und eine Diskriminierung von Mädchen und Frauen. Sie ist nicht zu dulden, sondern muss aus KDFB-Sicht weltweit abgeschafft werden. Betroffene leiden ihr Leben lang an den körperlichen, seelischen und sozialen Folgen der Beschneidung, die aufgrund von Traditionen und Normen, kulturell geprägten Vorstellungen von Weiblichkeit, gesellschaftlichem Druck, männlicher Macht und vermeintlich religiösen Argumenten vollzogen wird.
Der KDFB setzt sich dafür ein, dass Frauen grundsätzlich ein selbstbestimmtes, gewaltfreies und eigenverantwortliches (Sexual-)Leben führen können. „Frauen sind Subjekte und keine Objekte, über die eine andere Person bestimmen kann. Es muss überall verstanden werden, dass Genitalverstümmelung ein nicht wiedergutzumachendes Verbrechen ist. Frauenrechte sind Menschenrechte, ohne Wenn und Aber“, so Sabine Slawik. Von der Politik fordert der KDFB, erlittene und drohende Folgen der Genitalverstümmelung konsequent als geschlechterspezifische Verfolgung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) anzuerkennen. Unabhängig vom Grad der Beschneidung (partielle oder vollständige Entfernung der weiblichen Genitalien) muss ein Anspruch auf Asyl in Deutschland bestehen.
Außerdem sollen Frauen und Mädchen, die von Genitalverstümmelung betroffen oder bedroht sind, frühzeitig rechtlich und fachmedizinisch aufgeklärt werden. Beratungen müssen niedrigschwellig und kultursensibel erfolgen. Das Thema soll Bestandteil der Ausbildung von Ärzt*innen, Hebammen, Sozialarbeiter*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen werden, damit sie für den Kontakt mit Betroffenen gut geschult sind.